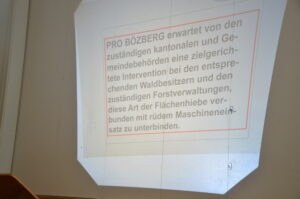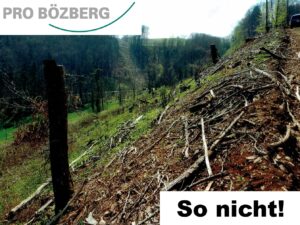Mitgliederversammlung Pro Bözberg 10. April 2019
Professor Wildi berichtet der Versammlung, dass die Standortsuche für die Lagerung von radioaktiven Abfällen in der Schweiz vor rund 70 Jahren begann, 1949. Er erinnere sich als damaliger Student an Sondierbohrungen im Winter 1969/1970 im Aargau für schwach radioaktive Abfälle. Nach damaligem Fahrplan sei geplant gewesen, das Endlager 1990 zu eröffnen. Heute sei er der Überzeugung, dass er die Eröffnung des Endlagers nicht mehr erleben werde. Prinzipiell sei man heute im Jahr 2019 gleich weit wie damals in den frühen 1980er Jahren. Damals hätten schon Probebohrungen in Riniken und Schafisheim stattgefunden.
Weltweit belaufe sich der hoch radioaktive Abfall auf rund 12‘000 Tonnen nach aktuellen statistischen Erkenntnissen. In der Schweiz würde der seit Aufnahme des Betriebs aller Kernkraftwerke (KKW) insgesamt entstandene (hoch-, mittel- und schwachaktive) Abfall ungefähr die Bahnhofhalle des Hauptbahnhofs Zürich mit ca. 100’000 Kubikmeter füllen. Dieses entspreche rund 0,5 % der weltweiten Produktion der Abfälle aus der „friedlichen“ Nutzung von Atomenergie durch die Schweizer KKWs.
Relevant sei aber nicht die Quantität der Abfälle, sondern deren Toxizität. Weltweit habe man sich auf eine einheitliche Strategie des Umgangs mit dem Abfall, wie sich herauskristallisiert, geeinigt: Die geologische Endlagerung. Dieses sei die offizielle Version.
Was man hingegen wirklich mache, sei Zwischenlagerung. Dieses sei auch in der Schweiz der status quo. Es sei unbekannt, wie lange dieser Zustand dauern werde.
Es bestehe ansatzweise eine Alternativstrategie: Die Transmutation von hochaktiven Abfällen. Die Umwandlung von Atommüll zu dessen Entschärfung. Momentan werde das nicht aktiv weiter verfolgt.
Es bestehe weiter ein internationaler Konsens, dass jedes Land seinen eigenen Atomabfall zu entsorgen habe. Derzeit bestehe ein einziges geologisches Endlager weltweit: in Finnland; es habe jedoch noch keine Betriebsbewilligung. Es biete Platz für den Abfall von 5 finnischen KKWs. Diese Menge sei vergleichbar mit derjenigen der Schweiz. Das Problem dabei sei, dass die Schwedische Justiz die Kupfer-Ummantelung der Abfallbehälter bis auf weiteres ausgesetzt habe. Grund dafür seien gravierende materialtechnische Fragen; diese „Lösung“ sei daher derzeit blockiert. Deswegen gehe es auch in Schweden nicht vorwärts. Ein weiteres Problem sowohl in Schweden wie in Finnland sei, dass das geologische Endlager in zerklüftetem und daher wasserdurchlässigem Granit liege. Frankreich habe ein eher aussichtsreiches laufendes Verfahren für ein Endlager in Bure (Dept. Haute-Marne); hier besteht das Wirtgestein, so wie im schweizerischen Referenzkonzept, aus einem geringdurchlässigen Tongestein. Die USA müssten nach Rückschlägen wieder praktisch von vorne beginnen. In Deutschland sei es genauso.
Die Schweizer Behörden planten die Fertigstellung des Endlagers für das Jahr 2050 (schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) sowie 2060 für die hochaktiven Abfälle (HAA). Der Termin verschiebe sich allerdings stets kontinuierlich weiter in die Zukunft.
Die Schweizer Lösung sehe Endlager in einer Tiefe von rund 500 m – 900 m vor. Das Wirtgestein sei die Formation des Opalinustons. Eine Maxime des Konzepts in der Gestaltung des Tiefenlagers sei die Möglichkeit, dass künftige Generationen die eingelagerten Abfallbehälter weiter überwachen und gegebenenfalls wieder zurückholen könnten.Die konkrete Ausgestaltung der Lagerung von HAA nach dem aktuellen Schweizer Konzept entspreche allerdings in etwa dem bald 50-jährigen schwedischen Konzept aus den 1970er-Jahren. Man wolle die verbrauchten Brennstäbe in Behälter aus Stahl-Zylindern in Stollen einlagern, die vorgängig aus dem Ton des Wirtgesteins herausgefräst worden wären. Allmählich würde sich der Ton infolge der Bergfeuchte aufblähen (quellen) und dadurch die zylindrischen Behälter in den Stollen dicht versiegeln, so dass auch dort kein Wasser reinkomme. Problematisch sei der Umstand, dass Ton plastisch werde beim Kontakt mit Wasser. An sich sei Ton wegen seiner selbstabdichtenden Eigenschaften ein sehr geeignetes Material. Diese Plastizität bei Wasserkontakt erschwere aber die Erstellung von begehbaren Stollen durch Maschinen und Menschen. Würden diese Stollen zu gross ausgestaltet, fielen sie früher oder später in sich zusammen durch den Kontakt mit Grundwasser. Für dieses Problem bestehe noch keine robuste Lösung.
Abgesehen davon handle es sich um ein grundsätzlich „charmantes“ Konzept. Das Problem sei, dass es schwer umsetzbar sei. Die sich aus technisch-wissenschaftlicher Sicht stellenden Probleme würden weder seriös wahrgenommen noch gründlich angegangen. Das Ausmass der Langzeit-Korrosion der Stahlzylinder sowie das Verhalten der Bentonit-Verfüllung seien zu wenig untersucht.
Es fehle sowohl bei den Entsorgungspflichtigen (Nagra) als auch bei den Behörden (Ensi, BfE) der Wille, die offenen Fragen aus technisch-wissenschaftlicher Sicht überzeugend zu untersuchen und auf Langzeiteignung zu testen. Es bestehe quasi eine technische Blockade. Es gebe weder Fortschritte noch Verbesserungen. Dazu gesellen sich gravierende Defizite bei der Organisation des ganzen Projekts im Sachplanverfahren.
Das derzeit vom Bundesamt für Energie schwach geführte Sachplanverfahren räume der Sicherheit und den Risiken wenig Priorität ein. Es sei in erster Linie ein politischer Prozess. Dieser politische Prozess könnte letztlich ablenken von der möglichen Nicht-Eignung eines gewählten Standortes gemäss den wissenschaftlichen Kriterien. Politische Machbarkeiten könnten höher gewichtet werden als wissenschaftliche Sicherheitsüberlegungen.
Der Standort Bözberg weise zahlreiche mögliche Nutzungskonflikte im Gesteinsuntergrund auf. Frühere Bohrungen zeigten, dass ein hohes Potenzial an Kohle, Gas und vielleicht sogar Öl vorhanden sei. Eine spätere Ausbeutung dieser Ressourcen durch künftige Generationen könnte zu einem Absenken von Bodenschichten, ggf. zum ungewollten Durchbohren endgelagerter Substanzen führen. Bund und Nagra sehen die „Lösung“ dieses Konflikts in einem rechtlichen Verbot der Ausbeutung. Doch das Lager mit hochaktiven Abfällen habe einen zeitlichen Horizont von mehreren zehntausend Jahren. Es könne realistischerweise aus rechtlicher Sicht nicht über einen solchen Zeitraum und über zahlreiche Generationen sichergestellt werden, dass eine solche Regelung fortbestehe und ggf. auch rigoros durchgesetzt würde. Verbote könnten auch wieder aufgehoben – oder ganz einfach „vergessen“ werden. Daher sei der Bözberg als HAA-Standort ungeeignet. Auch sei eine Interferenz möglich mit Transportwegen und mit der Zementindustrie (Abbauvorhaben in Steinbrüchen). Dieses sei auf dem Bözberg durchaus realistisch.
Zudem bestünden geologische Strukturen mit tektonisch gestörten Zonen. Allein aufgrund dieser Tatsache sei die Langzeit-Sicherheit des Standorts Bözberg fraglich.
Die Finanzierung des Endlagers und der Weg dorthin sei im Jahr 1983 auf rund zwei Milliarden Schweizer Franken geschätzt worden. Im Jahr 2019 sei man inzwischen bei 25 Milliarden Schweizer Franken angekommen. Die Schätzung sei linear gestiegen mit jedem weiteren Arbeitsschritt und mit immer neu hinzugekommenen Erkenntnissen über Problemstellungen und deren Auswirkungen auf die Gesamtkosten. 2020 beginne der Rückbau des KKW Mühleberg. Daraus könnten weitere Hinweise auf zusätzliche Kosten entstehen. Es könnte noch viel, viel teurer werden.
1969 wurde das erste KKW in der Schweiz ans Netz genommen und das letzte 1983. Seit ca. 80 Jahren werde in der Schweiz die Atomkraft genutzt. Die Hälfte der aktuell geschätzten Endkosten von rund 25 Milliarden Schweizer Franken sei momentan gedeckt (Entsorgungsfonds). Der Rest sei noch nicht angespart worden.
Ereignete sich ein grosser Unfall in nächster Zeit in Europa, müsste mit einer sofortigen Stilllegung aller KKWs in der Schweiz gerechnet werden. Dann entfiele weiterer Gewinn und folglich weitere Ersparnis für die restlichen 12,5 Milliarden Schweizer Franken. Diese müssten dann durch die öffentliche Hand finanziert werden.
Ethisch betont zwar die aktuelle Planungsorganisation, Sicherheit für Mensch und Umwelt zuoberst auf die Agenda zu schreiben. Handlungsziel sei, das Problem so zu lösen, dass künftige Generationen, falls diese eine Lösung für die Abfallproblematik fänden, das Endlager wieder „rückholen“ könnten. Auch werde mit der Lösung durch unsere Generation das Verursacherprinzip bestmöglich umgesetzt.
Die Realität zeigt jedoch, dass dieses Verursacherprinzip derzeit ohnehin nicht eingehalten werde und auch nicht mehr eingehalten werden könne. Man habe sich das „Ei bereits gelegt“ für die bestehende und künftige Generationen. Die Finanzierung sei nicht sichergestellt. Eigentlich sei das völlig inakzeptabel. Man lebe derzeit in einer kollektiven Mitschuld, ähnlich wie beim Klima. Wir seien diesbezüglich eine verantwortungslose Generation.
Politisch sei die Stimmung bezüglich der Endlager stark schwankend und abhängig von äusseren Faktoren. Ereignisse wie in Fukushima würden viel Dampf in den Kessel bringen. Nach einem solchen Ereignis sei dann der Dampf bald wieder weg. Betreiberfirmen der KKWs wie die Alpiq und die Axpo gehörten zwischenzeitlich praktisch vollständig der öffentlichen Hand. Betreiber der KKWs seien eigentlich die Kantone.
Das Interesse in der Bevölkerung hinsichtlich der Endlager-Standortwahl habe abgenommen. Der Druck sei weg. Es bestehe eine unklare Zukunft. Vielleicht fänden wir gar keine Lösung mehr in diesem Jahrhundert. Die letzten 50 Jahre Arbeiten auf diesem Thema hätten eigentlich zu praktisch nichts geführt. Man habe nichts erreicht. Das Thema habe zudem an Aktualität eingebüsst auf der politischen Agenda. Erschwerend komme hinzu, dass auch die aktuelle Stossrichtung aus wissenschaftlicher Sicht fraglich sei. Die derzeit geplanten Sondierbohrungen bringen aus seiner Sicht wenig Neues, insbesondere bezüglich der drängenden Fragen zu den akuten Nutzungskonflikten im tiefen Untergrund. Es werde absichtlich nicht tief genug gebohrt. Das Projekt in Frankreich sei erfolgsversprechender: Überzeugendes Einlagerungskonzept, keine Nutzungskonflikte mit Kohlenwasserstoff-Ressourcen im Untergrund, tektonische Stabilität (Erdbeben) etc.
Das Referat wird mit grossem Applaus durch die Versammlung verdankt. Der Präsident bittet um Erläuterungen zur Folie mit dem Profil zum Querschnitt der Gesteinsschichten im Kanton Aargau vom Rhein bis zum Hallwiler-See. Prof. Wildi nimmt detailliertere Erläuterungen vor. Er gibt auch zu bedenken, dass die Bohrtechnik in den letzten Jahren starke Fortschritte gemacht habe und mit einer Tiefe von 500 m – 900 m selbst das Risiko von terroristischen Motiven nicht ausgeschlossen werden könne. Mit aktueller Bohrtechnik könne man in rund einer Woche bis auf diese Tiefe vordringen.
Vorstandsmitglied Theo Sonderegger bittet um weitere Erläuterungen zum internationalen Ansatz. Prof. Wildi betont, dass die USA ursprünglich den „Lead“ hatten. Allerdings zeichnete sich dann eine Art Konsens ab, dass jedes Land eigenverantwortlich den eigenen Atommüll beseitigen solle. Aus wissenschaftlicher Sicht sei dieses Verhalten unvernünftig, weil der global bestgeeignete Standort gefunden werden sollte. Die Suche sollte nicht in einzelnen Ländern nach politischen Zuteilungen der Territorialität stattfinden. Die Wahl nach dem sichersten und dem bestgeeigneten Standort sollte aus wissenschaftlicher Sicht weltweit ohne Einschränkung von Landesgrenzen stattfinden. Es sei insbesondere rücksichtlich der kriegerischen Veränderungen von Territorien und Ländern in den letzten tausend Jahren fragwürdig, ob das aktuell verfolgte Konzept der Eigenverantwortung der einzelnen Länder über tausend Jahre hinweg eine sinnvolle Lösung sei.
Ein namentlich nicht bekannter Herr aus dem Publikum erkundigt sich, ob die Förderung von Kohle realistischerweise wieder aktuell werden könnte. Prof. Wildi vertritt die Auffassung, dass sich eine Tendenz abzeichne, künftig wieder Kohle aus Gesteinsschichten zu fördern. Das sei denkbar. Die Technik habe sich in diese Richtung entwickelt und entwickle sich derzeit weiter. Zwar sei Afrika für diese Kohleförderung in der Tiefe besser geeignet, da es weniger warm sei im Untergrund als in Europa. Hierorts nehme die Temperatur um 30 °C pro Kilometer Richtung Erdinneres zu. In Afrika seien es ca. 20 °C.
Der Präsident bittet um Erläuterungen zu den aktuellen Ansätzen von China und USA, mit neuen Techniken die Energiegewinnung aus Atomenergie schonender und mit weniger Abfall zu gestalten. Prof. Wildi meint dazu, es sei nur schwer zu prognostizieren, in welche Richtung diese Entwicklung führe. Sicher seien wirtschaftliche Motive im Vordergrund.
Ein namentlich nicht bekannter Herr erkundigt sich nach Versuchen des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) zur Transmutation (Umwandlung von Radionukliden). Gemäss Prof. Wildi hätten diese Versuche mit kleinsten Materialmengen stattgefunden, sie seien bisher ergebnislos geblieben.
Mitglied und Pressevertreter Peter Belart erkundigt sich, welches aus Sicht von Prof. Wildi nun die geeignete Lösung sei. Dieser bittet um die nächste Frage. Es bricht Gelächter aus. Ernsthaft erläutert Dr. Wildi, dass man nicht viel weiter sei, als zu Beginn der Überlegungen zur nuklearen Entsorgung. Der Umgang mit der Atomenergie sei ein grober Zivilisationsfehler. Es bestehe nach seiner Meinung keine „Lösung“. Man müsste aus seiner Sicht eine neue Auslegeordnung vornehmen. Man habe sich 50 Jahre lang in die falsche Richtung bewegt. Ein Neustart wäre sinnvoll. Aus seiner Sicht sollten die Landesgrenzen überwunden werden, um Lösungsansätze international verfolgen zu können. Ein schlechter Standort (z.B. auch in der Schweiz) könne die Sicherheit anderer Länder gefährden. Dafür bestehe allerdings im Moment international keine Einsicht. Man müsste mit den Nachbarn reden.
Frau Astrid Baldinger nimmt Anstoss daran, dass sie durch Vertreter der Organisation der Standortwahl orientiert worden sei, der Standort Bözberg sei „sicher“. Sie glaube dieses nicht. Prof. Wildi bestätigt, dass Prognosen wiederholt verfrüht gemacht worden seien und werden. Der aktuelle Prozess sei weitgehend politisch gesteuert statt wissenschaftlich-technisch. Die Standortfindung sei degradiert worden zu einer administrativen Leistung im Sachplanverfahren. Die Sicherheit sei in den Hintergrund gerückt. Auch wenn von „offizieller“ Seite jeweils das Gegenteil beteuert werde.
Der Präsident leitet über, dass diese Feststellung von Prof. Wildi exakt der Wahrnehmung von Pro Bözberg und seinem Vorstand entspreche. Die Haltung sei, dass Sicherheitskriterien imperativ vor politischer Machbarkeit stehen müssen. Dr. Wildi bestätige, dass hier der Verein sich weiter in diese Richtung engagieren solle.
Bericht erstellt vom Vereinsaktuar: Raphael Haltiner, redigiert durch André Lambert und Theo Sonderegger
Folien zu Gastreferat von Herrn Prof. W. Wildi